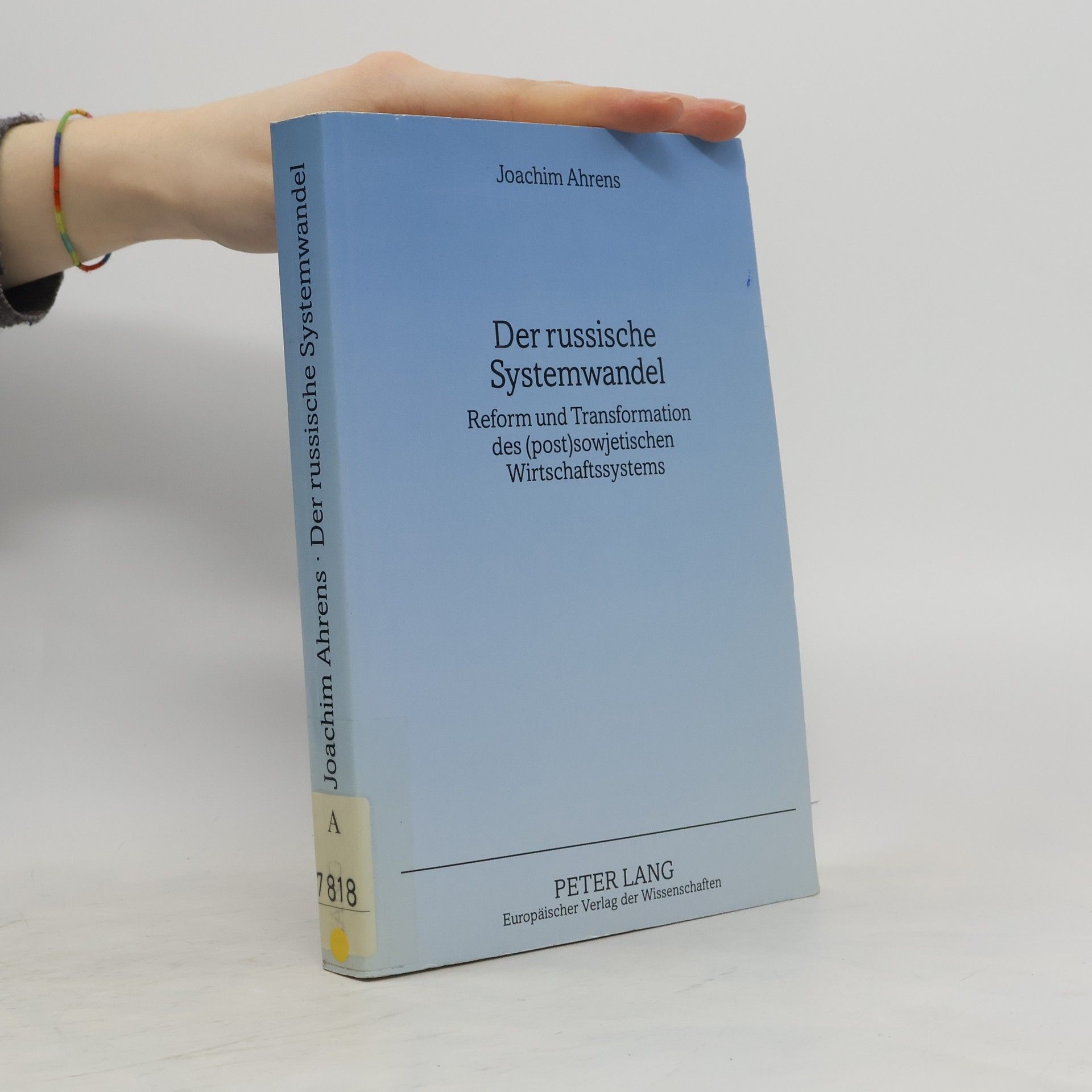Der Kollaps der sozialistischen Systeme in Mittel- und Osteuropa ist eines der herausragenden Ereignisse in diesem Jahrhundert. Die hierdurch implizierte Transformation ehemals sozialistischer Wirtschaftssysteme in Marktwirtschaften ist ohne historisches Vorbild. Am Beispiel der Russischen Föderation versucht diese Arbeit, einen Beitrag zur Entwicklung einer Theorie des Systemwandels zu leisten. Ausgehend von den Wirtschaftsreformen in der UdSSR nach 1985, wird eine geeignete Transformationsstrategie für die Russische Föderation entwickelt. Die Studie stellt einen interdisziplinären Ansatz zur Erklärung des russischen Systemwandels dar. Sie greift neben ökonomischen insbesondere politische und soziokulturelle Fragestellungen auf und diskutiert diese in ihrer jeweiligen historischen Dimension. Im Rahmen der Vergabe des Walter-Eucken-Preises durch die Friedrich-Schiller-Universität Jena erhielt die Studie eine Auszeichnung.
Joachim Ahrens Boeken