Ewald Banse bereiste zwischen 1906 und 1914 Tripolitanien, Mesopotamien, Syrien sowie Kleinasien und hinterließ ein umfangreiches Werk zu den Themen Orient, Okzident und Deutschland. Der Geograph war zunächst aus Abenteuerlust und Wissbegier aufgebrochen, entwickelte dann ein Modell zur Betrachtung, das die Abhängigkeit und die Beeinflussung des Menschen durch die Landschaft, in der er lebt, in den Vordergrund stellte. Seine Werke entstanden in der von Umwälzungen geprägten Zeit der Weltkriege und atmen daher auch den Geist von militärischer Mobilmachung, Rassedenken und zunehmender Heroisierung des Germanentums. Die Edition vereinigt zentrale Passagen seiner wissenschaftlich bislang nicht wieder publizierten Druckwerke sowie eine Anzahl grundlegender, nicht veröffentlichter Dokumente und Erzählungen aus Archivbeständen.
Ulrich van der Heyden Boeken
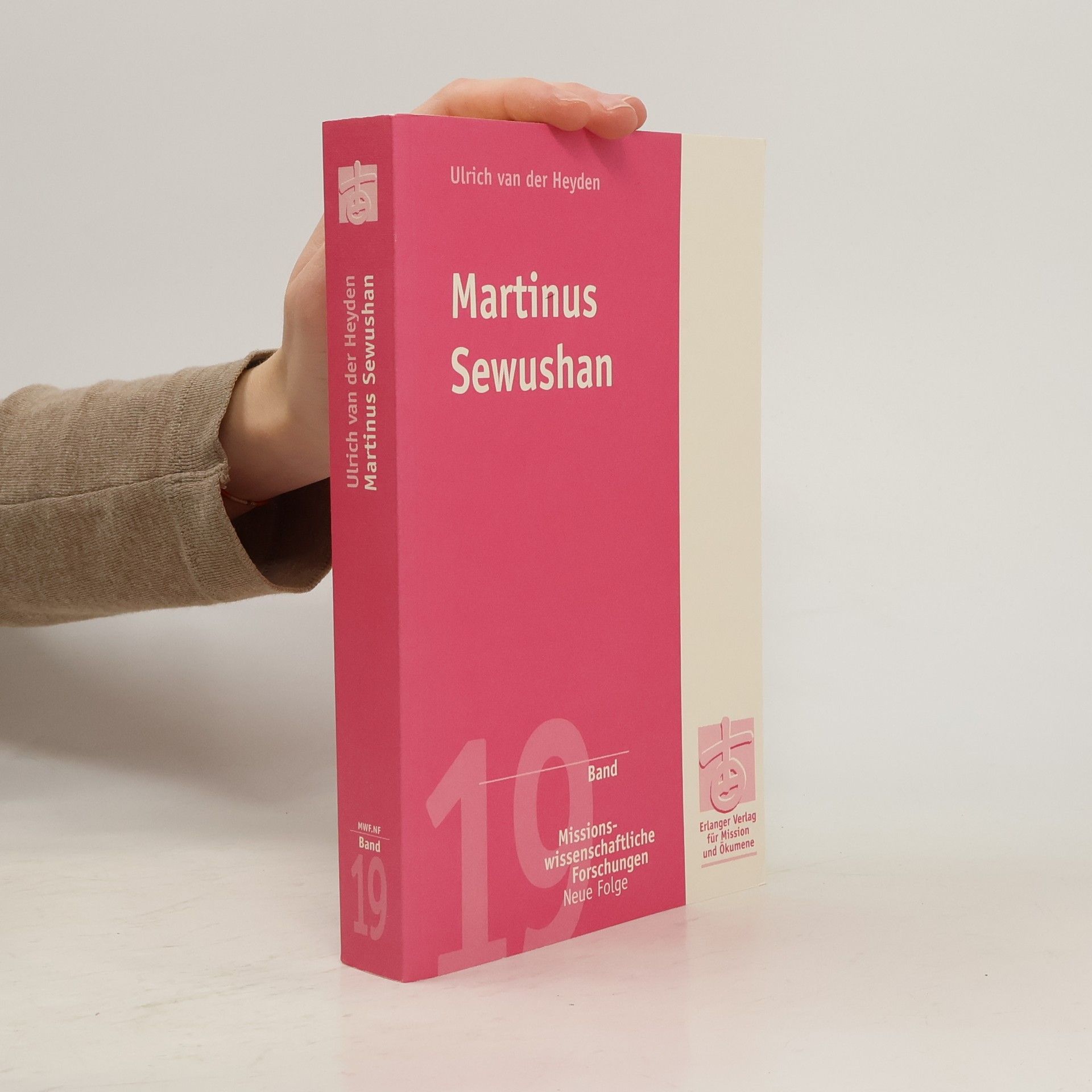





Die alten Kolonien sind Geschichte, das Erbe wirkt jedoch unverändert nach, wie Ulrich van der Heyden zeigt. Der international renommierter Kolonialhistoriker lehrt an Universitäten auf mehreren Kontinenten und setzt sich immer wieder kritisch wie kundig mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands auseinander. Dabei polemisiert er gegen oberflächliche Vereinfachungen, gegen einen ideologisch motivierten Aktionismus, der auf Ignoranz, Unkenntnis und auch auf Intoleranz gründet. Er streitet gegen unsinnige, auf Unwissenheit fußende Namensänderungen auf Straßenschildern ebenso wie gegen fragwürdige Rückgabeforderungen vermeintlicher Raubkunst. Er tritt politisch geformten Narrativen entgegen, mit denen bestimmte Ziele verfolgt werden. Deshalb nennt van der Heyden sein Buch eine Streitschrift. Er fordert mehr Sachlichkeit und plädiert für unbedingt notwendiges Wissen beim Umgang mit der eigenen wie auch der Geschichte der einst von der Kolonialmacht Deutschland unterjochten Völker. Denn in der aktuellen Debatte dominieren Unwissenheit, Ahnungslosigkeit und Emotionen. Seine Texte, in denen er sich polemisch mit aktuellen Beispielen auseinandersetzt, sind hilfreich, um die Irrwege in der gegenwärtigen Diskussion zu erkennen.
Der südafrikanische Burenkrieg 1899 bis 1902
in den Neuruppiner Bilderbogen
Die Affäre Patzig.
Ein Kriegsverbrechen für das Kaiserreich?
Missionsgeschichte, Kirchengeschichte, Weltgeschichte
Christliche Missionen im Kontext nationaler Entwicklungen in Afrika, Asien und Ozeanien
Martinus Sewushan
Nationalhelfer, Missionar und Widersacher der Berliner Missionsgesellschaft im Süden Afrikas
Martinus Sewushan gehörte zu der Gruppe afrikanischer Konvertiten, die von den europäischen Missionaren ausgebildet wurden, um als afrikanische Elite Führungspositionen in Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. Sewushan emanzipierte sich schon bald vom Paternalismus der Berliner Missionare und gründete 1890 die erste von der europäischen Missions-kirche unabhängige afrikanische Kirche, die Lutheran Bapedi Church, im Norden der heutigen Republik Südafrika. Das Verhältnis von Mission und Kolonialverwaltung, die Stellung deutscher Missionsgesellschaften zum Burenkrieg (1899 - 1902) und die Vorgeschichte der Afrikanisch Unabhängigen Kirchen werden ebenfalls untersucht. Die Darstellung wendet verschiedene sozialwissenschaftliche Ansätze an und will so ein Plädoyer für ein engeres wissenschaftliches Zusammenwirken von Missions-, Christentums- und außereuropäischer Geschichte sein.
Lexikon zur Geschichte, Kultur und Religion und über die gegenwärtigen Verhältnisse der nordamerikanischen Indianer. Mit Ausnahme einiger bedeutender Persönlichkeiten der Gegenwart werden lediglich nicht mehr lebende Personen berücksichtigt
