Hazel Rosentrauch hat eine faszinierende Studie zweier Menschen geschrieben und zugleich das eindringliche Bild einer Epoche entworfen. Wilhelm von Humboldt: der Diplomat, der Ästhet, der Sprachphilosoph, der Goethe- und Schillerfreund. Seine Persönlichkeit ist nicht denkbar ohne seine Frau, Caroline von Dacheröden, Mutter seiner fünf Kinder, in den Hauptstädten Europas zu Hause: eine Partnerin, die ihm an Weltneugier, Bildung, Kunstsinn und an tätiger Humanität ebenbürtig war. Die beiden verband eine Liebe »auf gleicher Höhe«, um »in dem engsten Verhältnis die höchste Freiheit zu behalten«. Anhand unzähliger Briefe, die sich die beiden über Jahrzehnte geschrieben haben, zeichnet Hazel Rosenstrauch mit kritischer Sympathie das Bild einer selbstbewussten Frau, deren Begriff von Liebe und Partnerschaft weit in die Moderne vorauswies, und das ihres Gefährten, der – an ihrem freien Wesen gewachsen – zu einem der großen liberalen Geister unserer Geschichte wurde.
Hazel Rosenstrauch Boeken

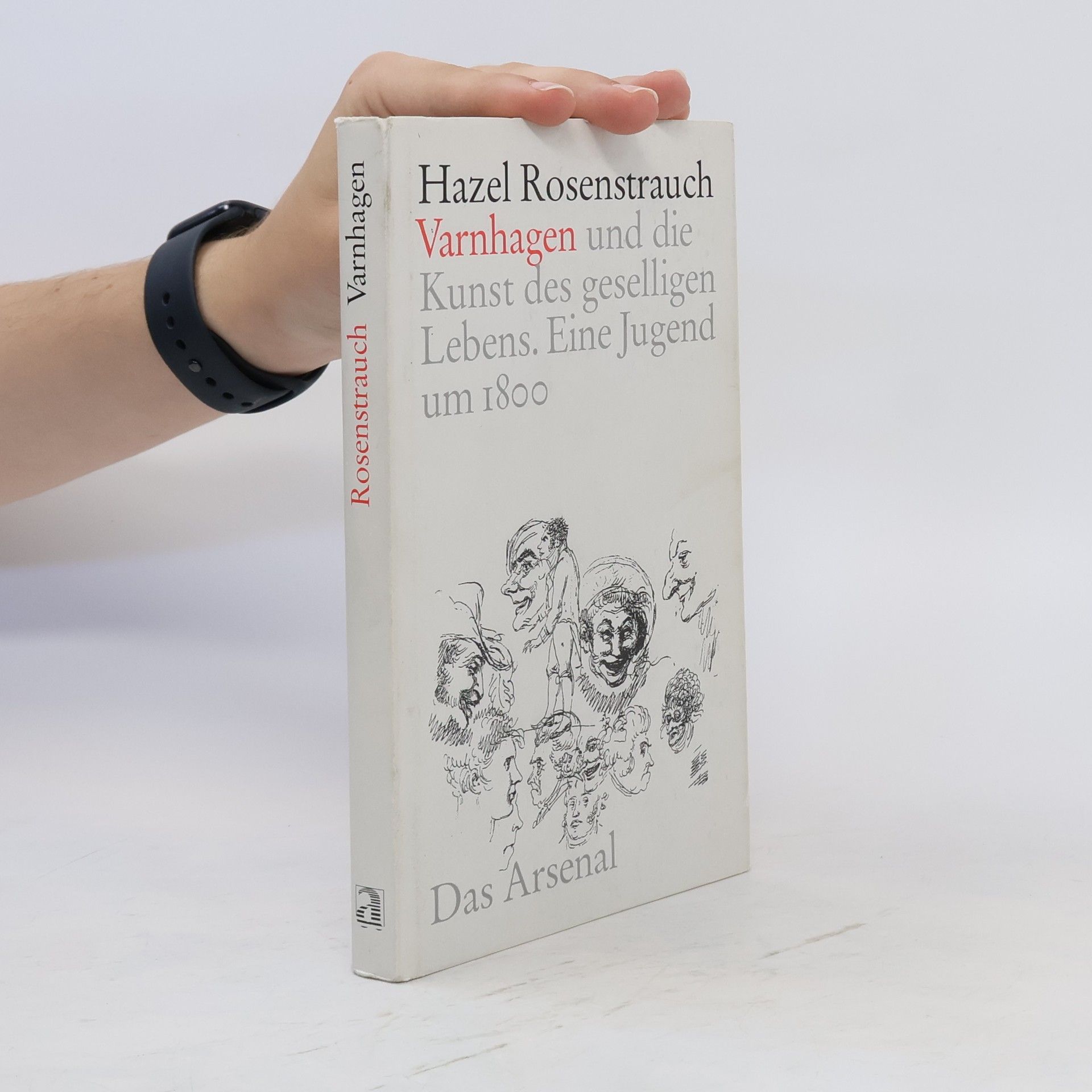
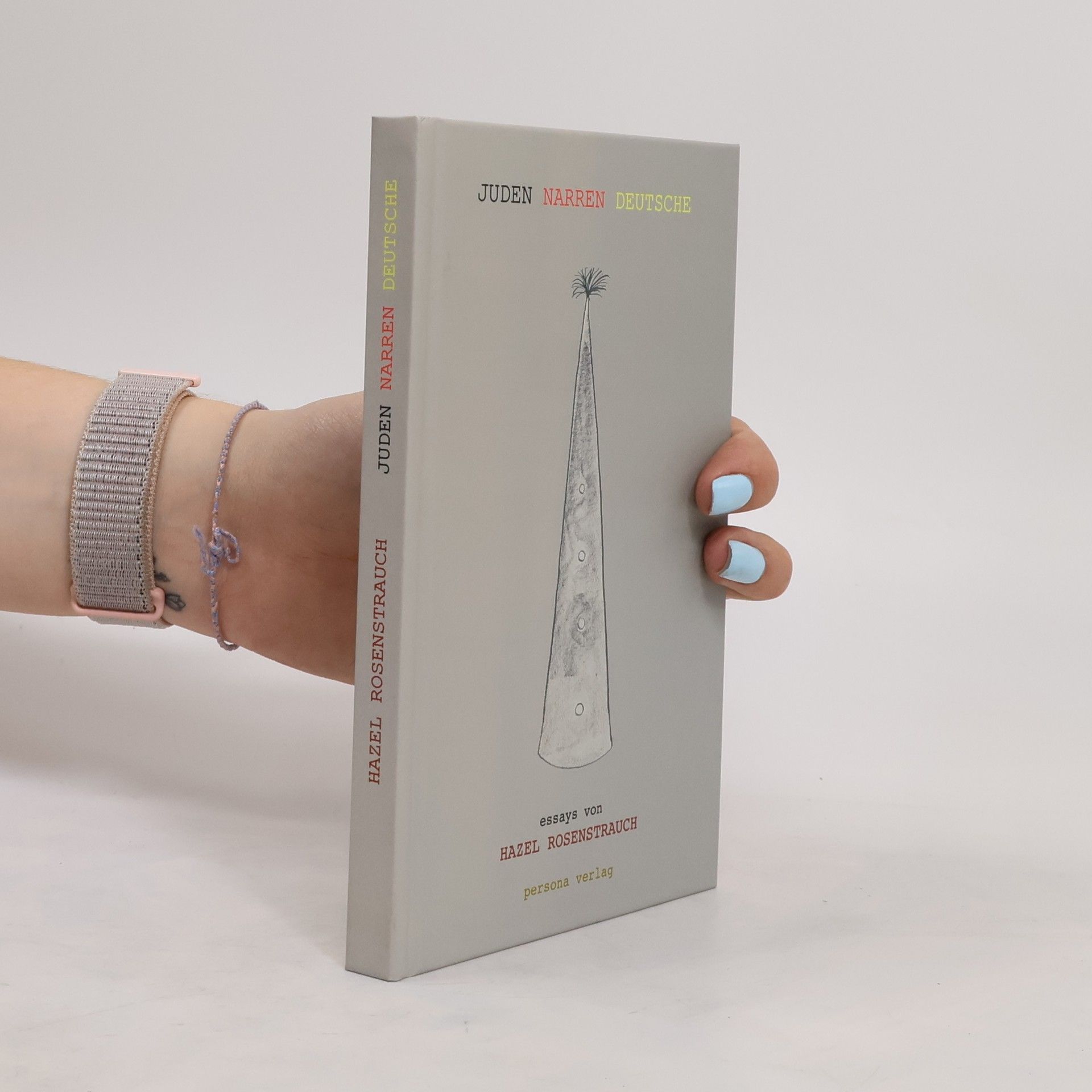


Der Wiener Kongress 1814/15: Napoleon war besiegt, seine Hinterlassenschaft konnte verteilt werden. Kaiser und Könige, Fürsten und Diplomaten aus ganz Europa kamen – mit Gattinnen, Schwestern, Geliebten und Dienerinnen – nach Wien. Und es wurde keineswegs nur getanzt. Den Damen der Wiener Hocharistokratie und der „Zweiten Gesellschaft“ fiel eine wichtige Aufgabe zu: In ihren Salons oder auch Boudoirs wurden Kontakte geknüpft und Formulierungen erprobt, Intrigen gesponnen und Geheimnisse verbreitet. Die Soiréen, Bälle und Empfänge fungierten als Vorzimmer der Verhandlungsräume, der Spaziergang auf dem Glacis oder der Besuch in einem Theater wurde für diplomatische Erkundungen genutzt. Hazel Rosenstrauch beleuchtet Schauplätze des Wiener Kongresses, stellt Nebenfiguren in den Vordergrund und erkundet, wie – bei allen Bemühungen um die Restauration des alten Regimes – Neues entsteht: in der Politik, in den Vorstellungen von Ordnung und Freiheit und im Umgang mit der Komplexität und den Unsicherheiten der Moderne.
Hazel Rosenstrauch bezeichnet sich als unjüdische Jüdin und nennt ihre Texte „Deutsche Studien“. Als Nachkömmin von Verfolgten beobachtet sie – skeptisch, heiter und auch böse – die Erinnerungskultur in Deutschland, Österreich und ein bisschen auch in Europa. Die Geschichten sind aus dem Leben gegriffen – in Berlin, in Wien oder auch in der Bischofsstadt Rottenburg. Denkmale, Stolpersteine und Orte der Erinnerung sollen mahnen. Wie aber wirken sie auf jemanden, der ständig an die Ausgrenzung seiner Vorfahren erinnert wird? Die Autorin wehrt sich gegen Zuschreibungen und möchte die verharschte Sprache aufbrechen.
Karl August Varnhagen ist meist nur noch bekannt als Mann seiner berühmten Frau, als "Wittwe" und Nachlaßpfleger der Rahel und ihres legendären "jüdischen Salons". Zu unrecht: er war ein liberaler, kosmopolitischer "homme de lettres", Feuilletonist, Kritiker, Sammler, Briefschreiber, Erfinder der biographischen Geschichtsschreibung; ein Meister der "geselligen Lebens-verhältnisse"; der unbequeme Chronist einer romantischen Generation, die um 1800 in Berlin und anderswo in die europäische Moderne aufbrach und meist im nationalen Biedermeier, in der Resignation oder im Exil endete.