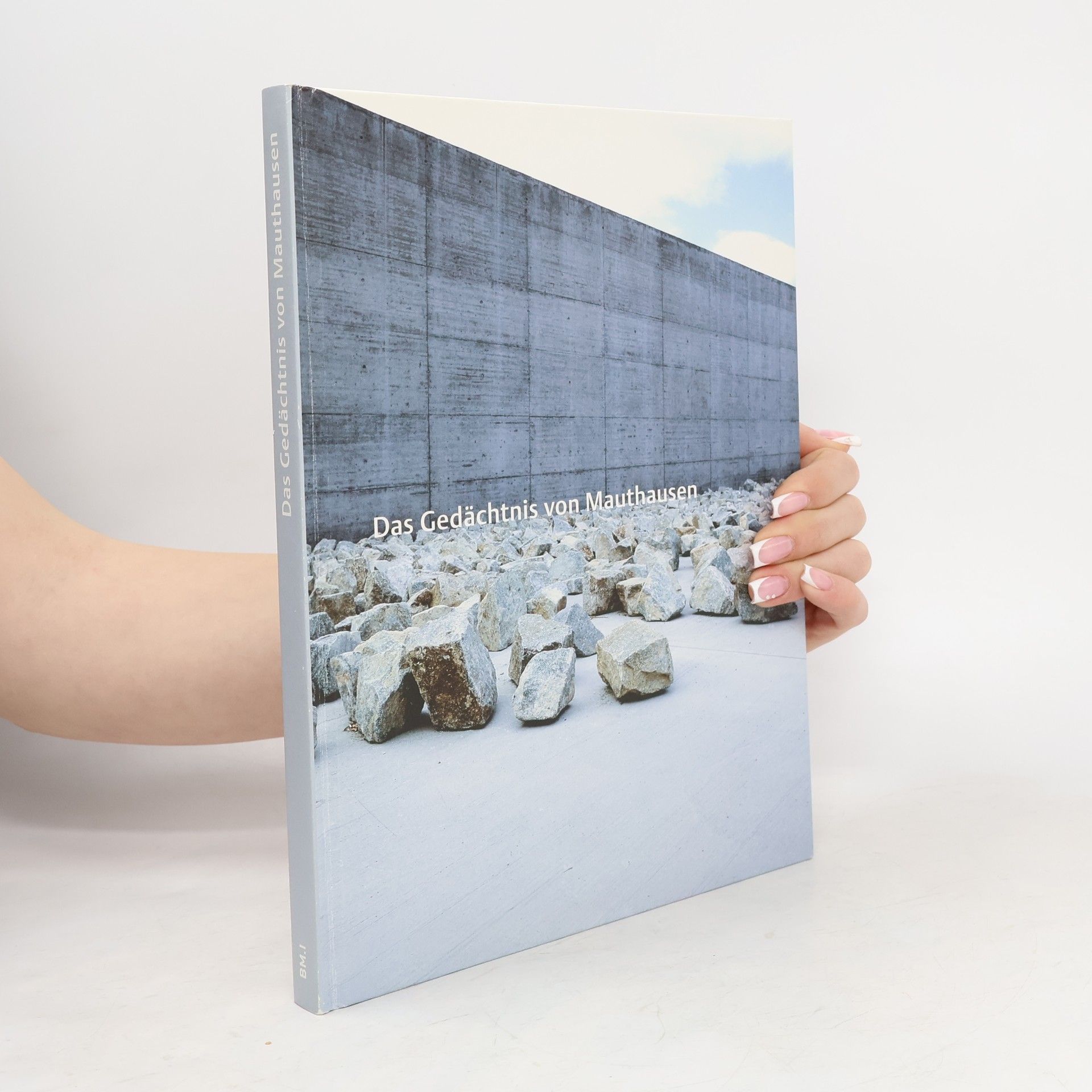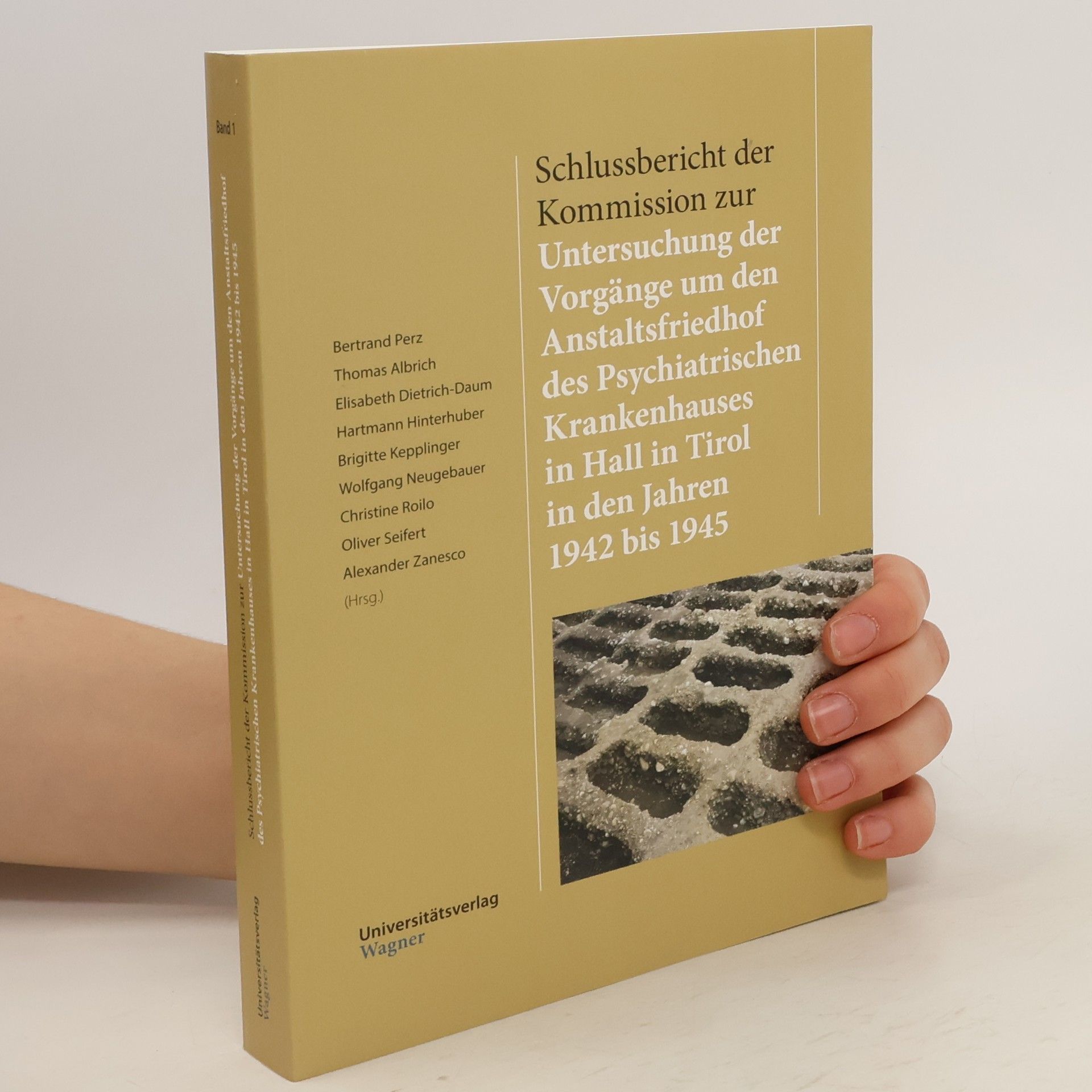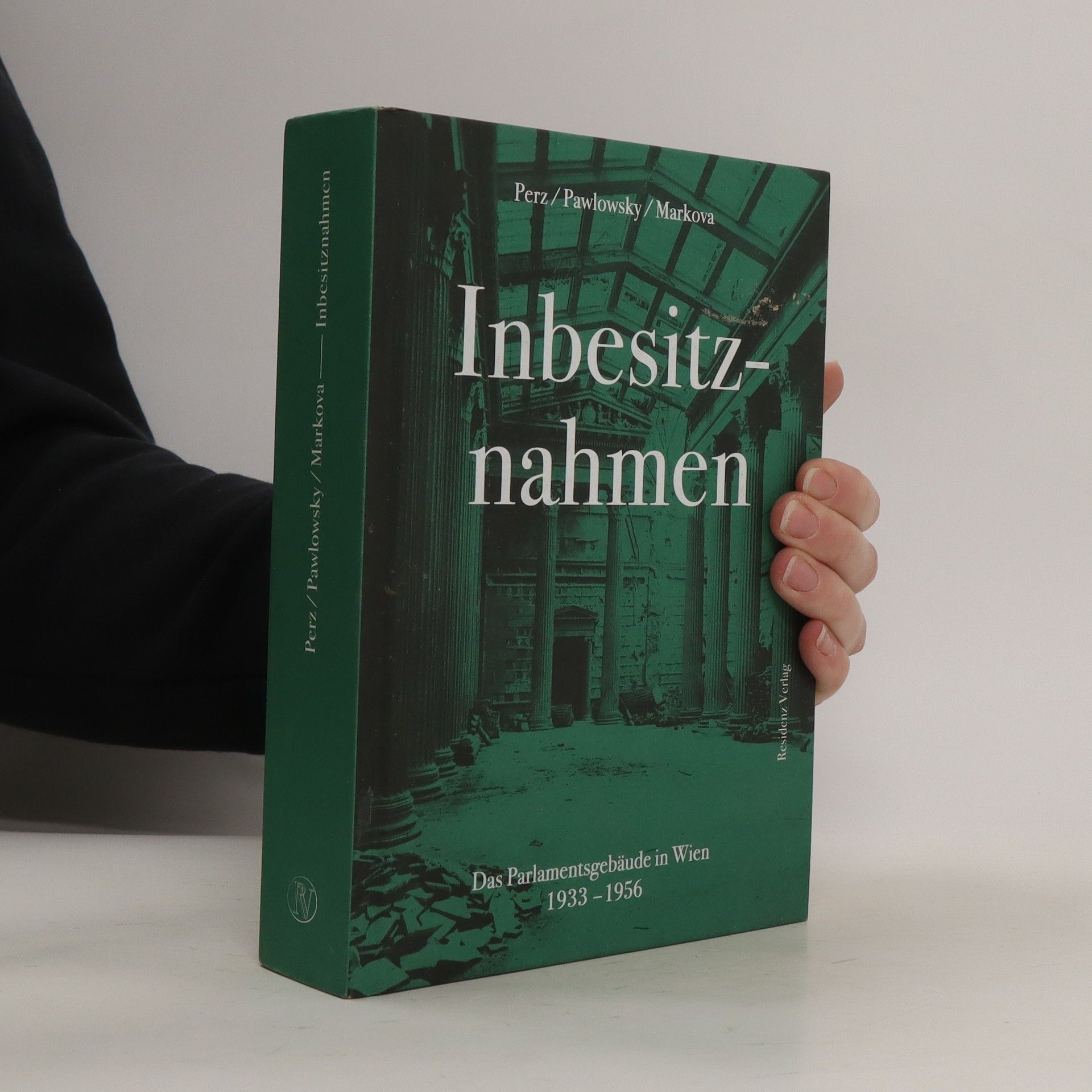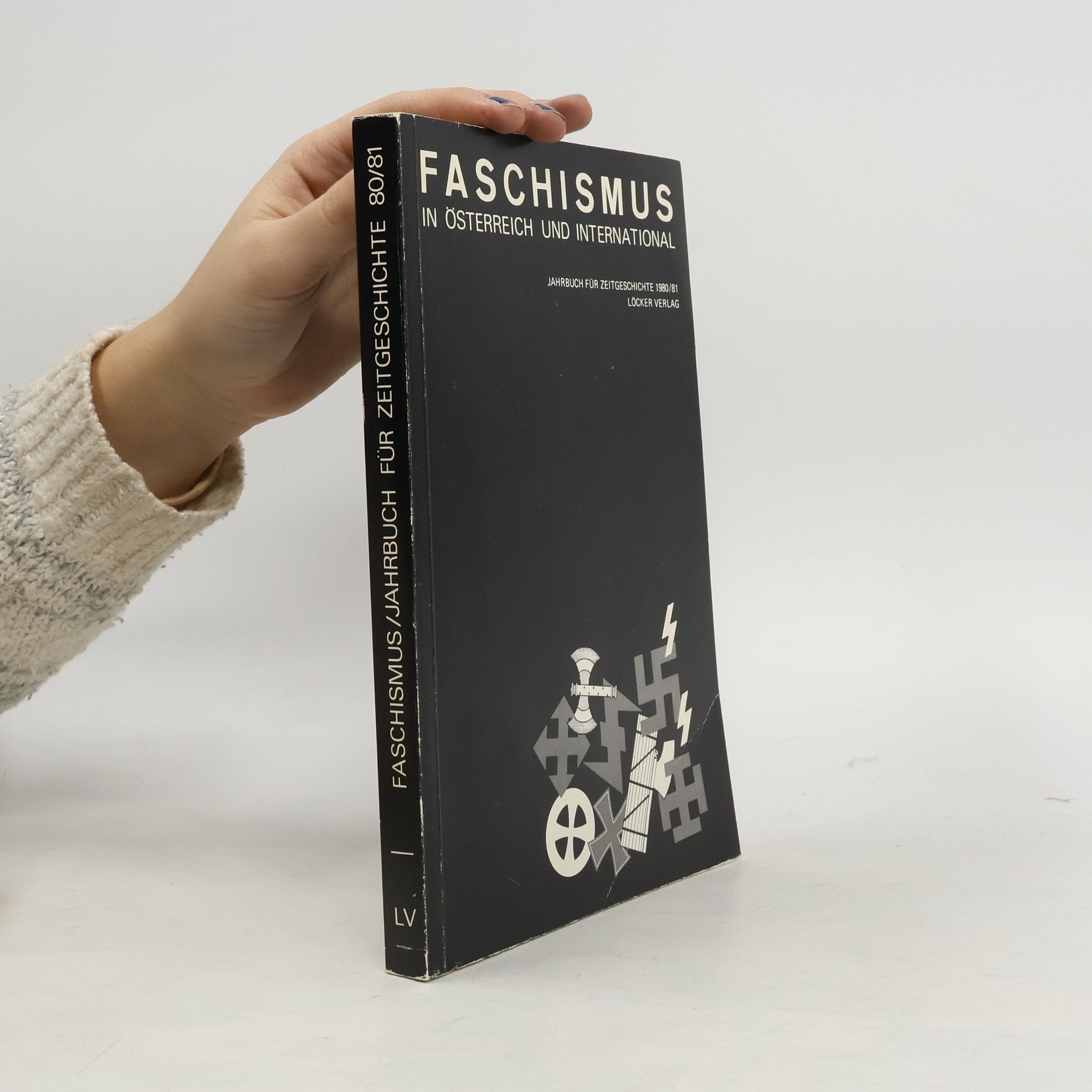Wasserstraßen
Die Verwaltung von Donau und March 1918–1955
Diese Studie geht erstmals der Geschichte jener Institutionen nach, die fur Ausbau, Regulierung und Instandhaltung von Donau und March als Wasserstrassen auf osterreichischem Staatsgebiet von 1918 bis 1955, einer Zeit massiver okonomischer wie politischer Umbruche, verantwortlich waren. Grosse europaische Flusse wie die Donau haben seit jeher eine mannigfache Bedeutung. Als lang genutzte Transportwege wurden sie im Industriezeitalter von staatlichen Behorden zu modernen Wasserstrassen entwickelt. Der Zustandigkeitsbereich dieser Einrichtungen wuchs und schrumpfte mit den sich verschiebenden Staatsgrenzen. Organisation und Aufgaben wurden mehrfach geandert, Teile des Personals durch die politischen Systemwechsel wiederholt ausgetauscht. Ein besonderer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Zweiten Weltkrieg, gepragt von der Eingliederung in die deutsche Reichswasserstrassenverwaltung, der Ausrichtung auf kriegswirtschaftliche Bedurfnisse und den mit Zwangsarbeit begonnenen Projekten des Ausbaus der Donau zu einer Grosswasserstrasse.