Max Ernst Museum Brühl
- 80bladzijden
- 3 uur lezen



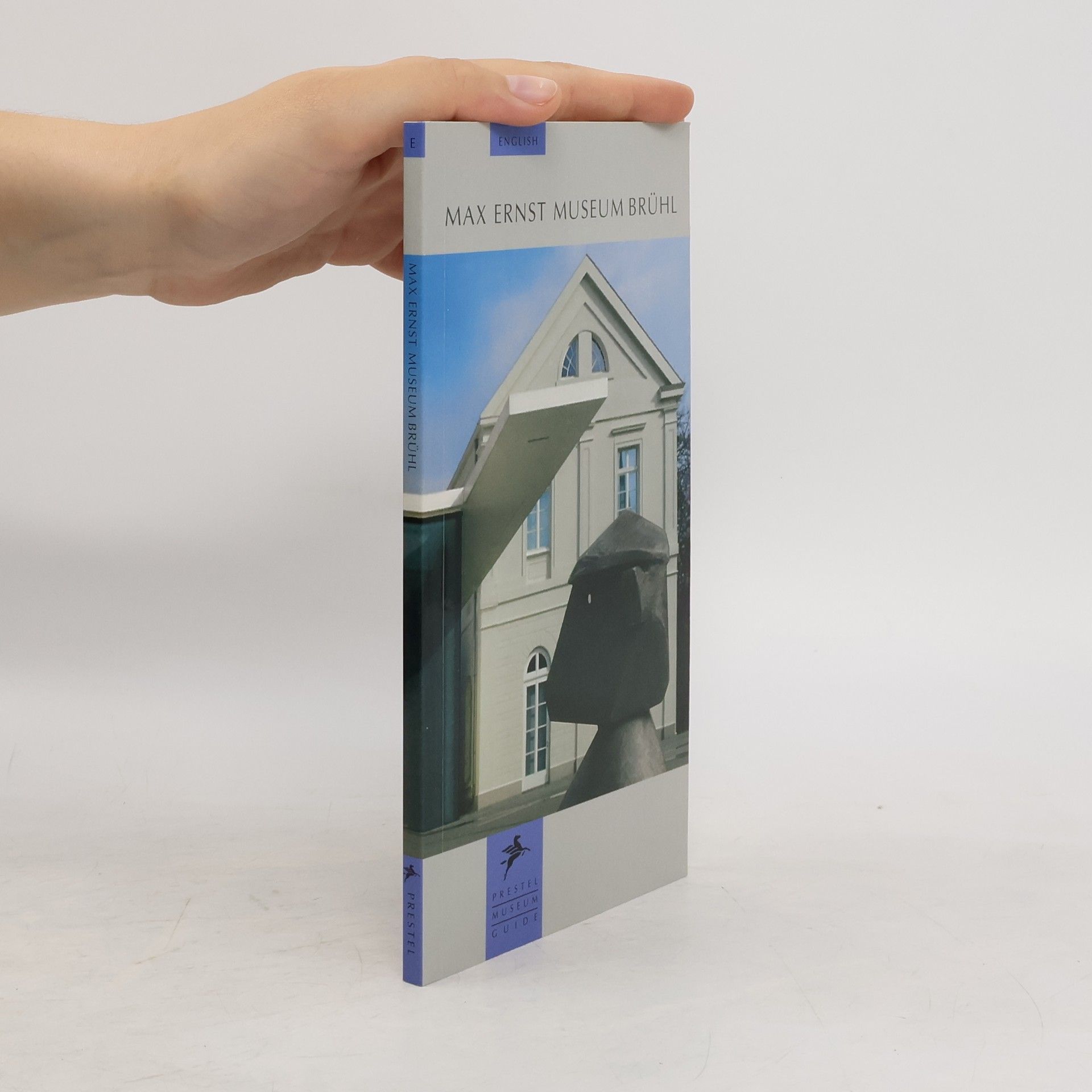
An ausgewählten Beispielen wird anschaulich erklärt, wie der französische Neo-Impressionist Seurat (1859-91) mit Tausenden von Farbpunkten flirrende Hitze, glitzerndes Wasser, Licht und Schatten malte
Besonders in Frankreich war die 1648 von Charles LeBrun gegründete 'Académie royale' eine nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch mächtige Institution, aus deren internen Lagerkämpfen um den richtigen Weg verbindliche Normen für die Kunst hervorgingen. Selbst die Revolution vermochte die Grundfesten ihrer Herrschaft nicht zu sprengen. Es bedurfte einiger innovativer Künstlerpersönlichkeiten, um der Kunst ihre schöpferischen Freiräume zurückzuerobern. Mit hochkarätigen Werken aus der National Gallery of Ireland und der Sammlung Rau für Unicef veranschaulicht der Band diesen kulturgeschichtlichen Prozess.
In einem Streifzug vom 15. bis 20. Jahrhundert macht die Publikation Lebenswelten von Malern und ihren Modellen erfahrbar. Im Künstleratelier lernt man den Auftraggeber in seinen Rollen kennen – etwa als spätmittelalterlichen Stifter, fürstlichen Heiratskandidaten des Barock oder als Familienmenschen der Frühromantik. Die Frage nach dem Porträt als Seelenbildnis führt uns sodann zu mittelalterlichen Vera-Ikon-Bildern Christi als Abdruck einer überpersonalisierten göttlichen Essenz, aber auch zu idealen Frauenbildnissen von Cranach bis Renoir und intimen Familienporträts der Künstler, die der Seele des geliebten Menschen in ihrem Abbild ewige Dauer verleihen sollen. Künstler u. a. Lucas Cranach d. Ä., Jan Pollack, Ludger Tom Ring d. J., Friedrich Sustris, Judith Leyster, Jan Mytens, Peeter Meert, Jean François Delyen, Georg Desmarées, Jean Etienne Liotard, Joseph-Siffred Duplessis, Giandomenico Tiepolo, Thomas Gainsborough, Camille Pissarro, Hilaire Germain Edgar Degas, Auguste Renoir, Edouard Vuillard, Cornelis Theodorus Marie van Dongen