Andreas Schmauder Boeken
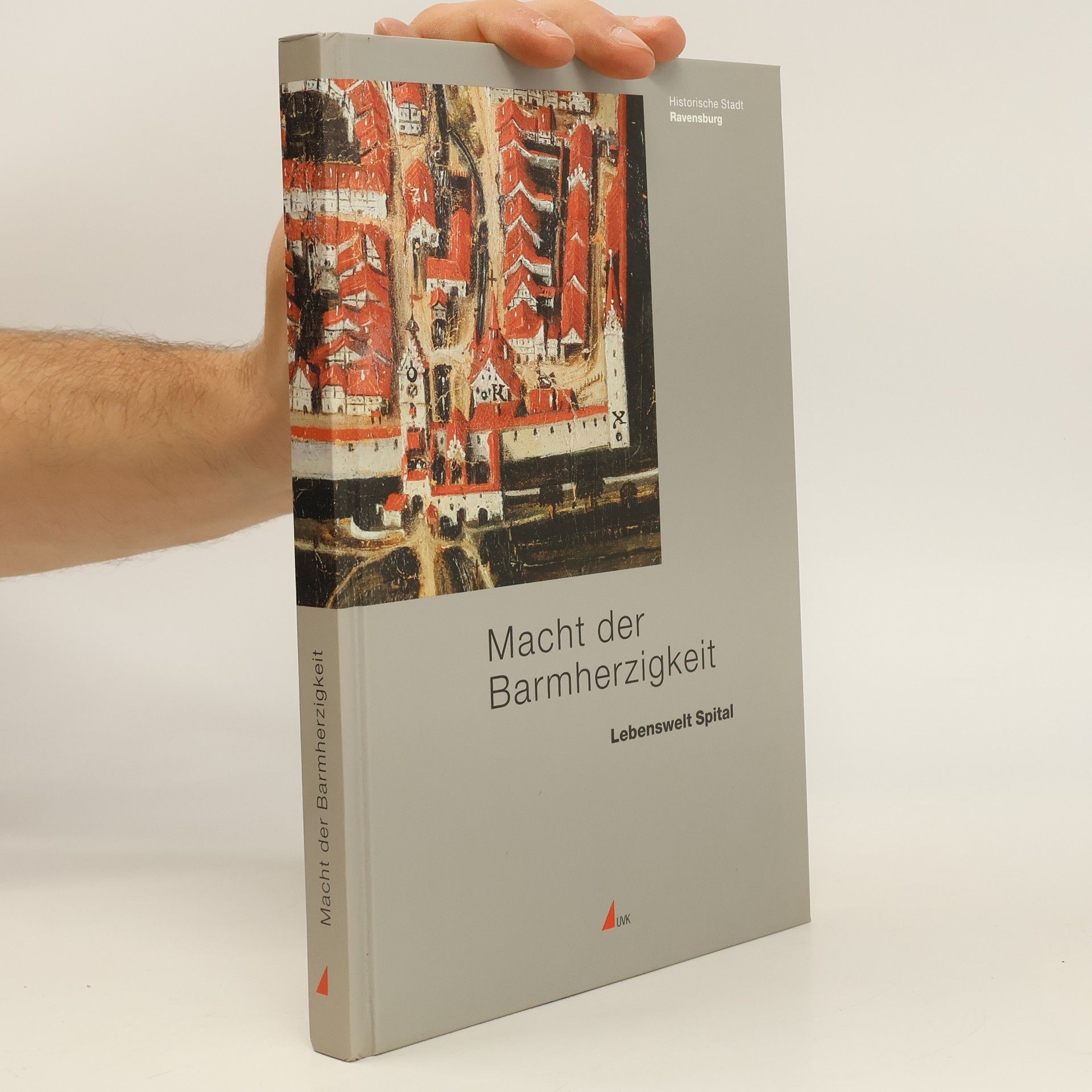


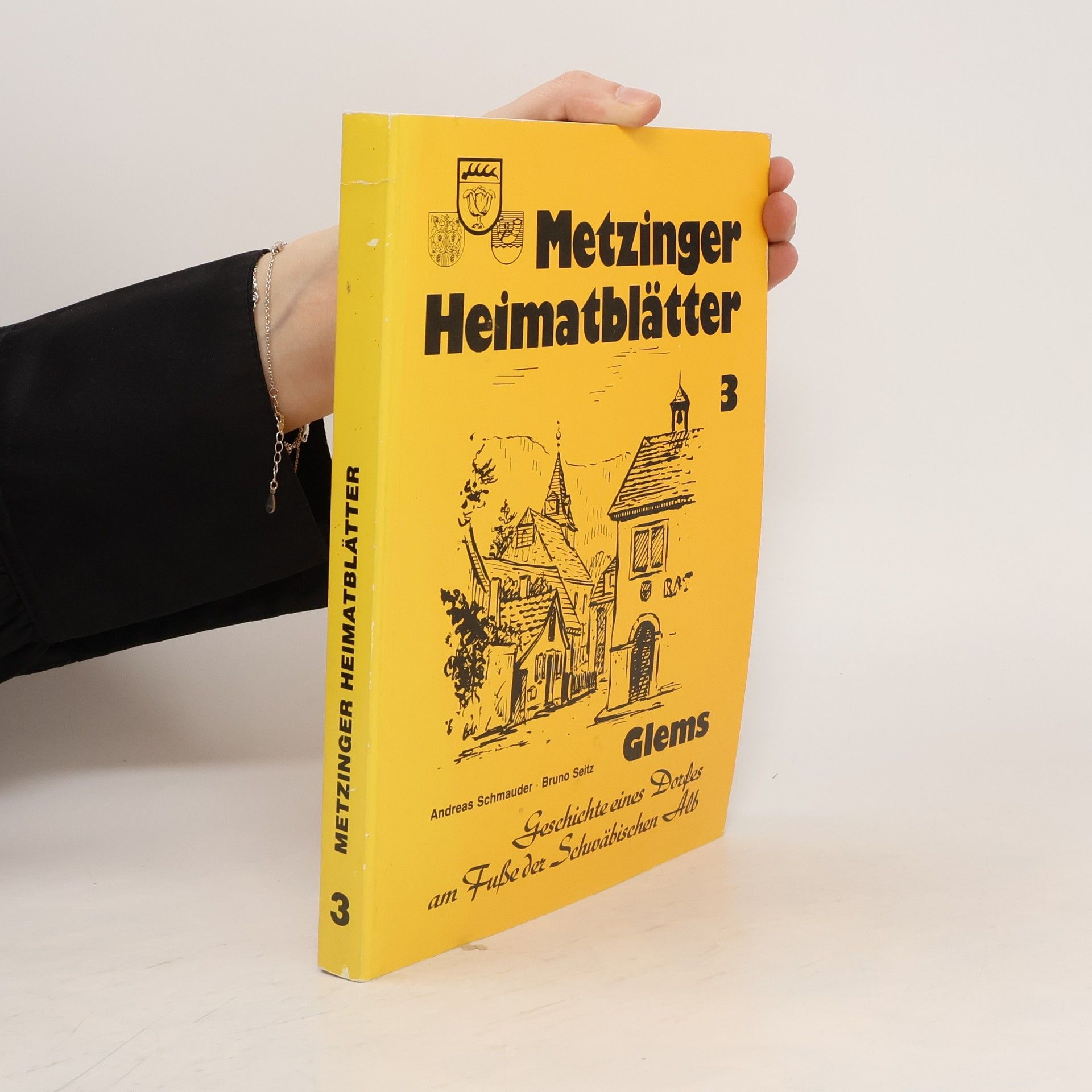
Die Stadt Ravensburg war über Jahrhunderte vor allem Marktplatz. Der im hohen Mittelalter von den welfischen Herzögen unterhalb der Veitsburg begründete Markt bildete die Keimzelle des frühen Ravensburg. Ihm verdankte die Stadt ihren Aufstieg und ihre Bedeutung. Der Markt wurde zum spezifischen Kennzeichen Ravensburgs. Inhaltsverzeichnis: Andreas Schmauder: Markt im hohen Mittelalter. Entstehung, Erstnennung 1152 und Bedeutung für Stadt und Umland Christine Brugger: Die Ravensburger Märkte im Spätmittelalter Beate Falk: Marktplätze und Markthäuser in reichsstädtischer Zeit Sabine Mücke: Kontrolle, Konflikte und Kommerz. Ravensburger Marktleben in der frühen Neuzeit Christine Brugger: Markt und Einzelhandel im 19. und 20. Jahrhundert
Ende des 15. Jahrhunderts begann im Bodenseeraum vergleichsweise früh die Verfolgung von Hexen. Allein im Bistum Konstanz wurden in den 1480er Jahren etwa 48 Frauen als Hexen verbrannt. Den Ravensburger Hexenprozessen kommt insofern überregionale Bedeutung zu, als dort der päpstliche Inquisitor Heinrich Institoris 1484 persönlich Prozesse durchführte. Institoris ist der Verfasser des Hexenhammer, jener verhängnisvollen Anleitung für die Verfolgung und Folterung von Hexen. Die Beiträge zu Heinrich Institoris, seinem Hexenhammer und der Verfolgung in Ravensburg und am Bodensee sowie die davon beeinflussten späteren Hexenprozesse in der Landvogtei Schwaben zeigen die Hexenverfolgung im Zusammenhang des religiösen und sozialen Lebens in Oberschwaben und der Region um den Bodensee. Inhaltsverzeichnis: Sönke Lorenz: Hexen und Hexenprozesse im deutschen Südwesten - eine Einführung Andreas Schmauder: Frühe Hexenverfolgung in Ravensburg - Rahmenbedingungen, Chronologie und das Netzwerk der Personen Andreas Blauert: Die Ravensburger Urfehden als Zeugnisse der Ravensburger Hexenverfolgung Wolfgang Behringer: Heinrich Kramers Hexenhammer - Text und Kontext Johannes Dillinger: Die Hexenverfolgung in der Landvogtei Schwaben im 16. und 17. Jahrhundert Andreas Schmauder ist Leiter des Stadtarchivs Ravensburg und Lehrbeauftragter an der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen.
Beiträge zur Geschichte des Heilig-Geist-Spitals in Ravensburg seit seiner Gründung 1287 vom Spital für alte, kranke und hilfsbedürftige Menschen bis zur modernen Geriatrischen Klinik. Dargestellt wird die historische Rolle der Bader, Chirurgen und Apotheker, die Lebensbedingungen im Spital und der Umgang mit Seuchen. Die Zeit des Nationalsozialismus bleibt ausgespart