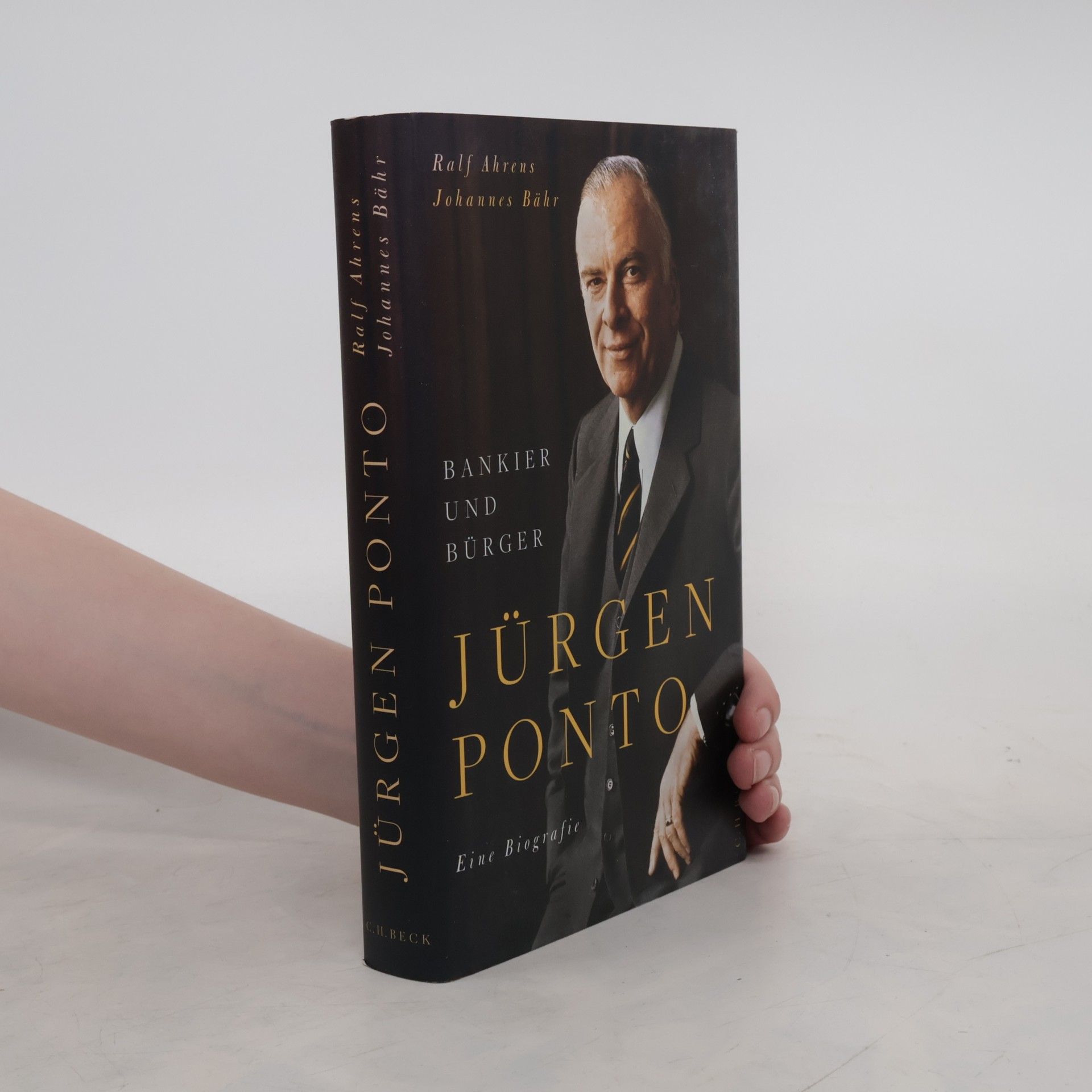Strukturpolitik und Subventionen
Debatten und industriepolitische Entscheidungen in der Bonner Republik
"Mit dem Abflauen des Nachkriegsbooms in den 1960er Jahren geriet die bundesdeutsche Industrie unter verstärkten Anpassungsdruck. Zunehmende Rufe nach staatlicher Unterstützung resultierten in Subventionen, die zur Dämpfung von Krisen der Deindustrialisierung ebenso eingesetzt wurden wie zur Förderung von Branchen, die als besonders zukunftsfähig galten. Die Etablierung eines neuen Politikfelds namens »Strukturpolitik« sollte diese Eingriffe in den wirtschaftlichen Strukturwandel gleichzeitig legitimieren und begrenzen. Forderungen nach einem drastischen Subventionsabbau standen jedoch in den 1970er und 1980er Jahren zunehmende Leistungen an die Industrie gegenüber. Das Feld blieb von Aushandlungsprozessen zwischen Politik und Wirtschaft sowie von einem Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Politikberatung und pragmatischer Praxis geprägt. Ralf Ahrens analysiert die Debatten über Legitimität und Formen industriepolitischer Intervention bis zum Ende der »alten« Bundesrepublik. In Fallstudien zur Stahlindustrie, zum Flugzeugbau und zur Computerindustrie zeigt er, dass die Subventionierung über Regierungswechsel hinweg vor allem von Branchenkonstellationen bestimmt war."--Page 4 of cover