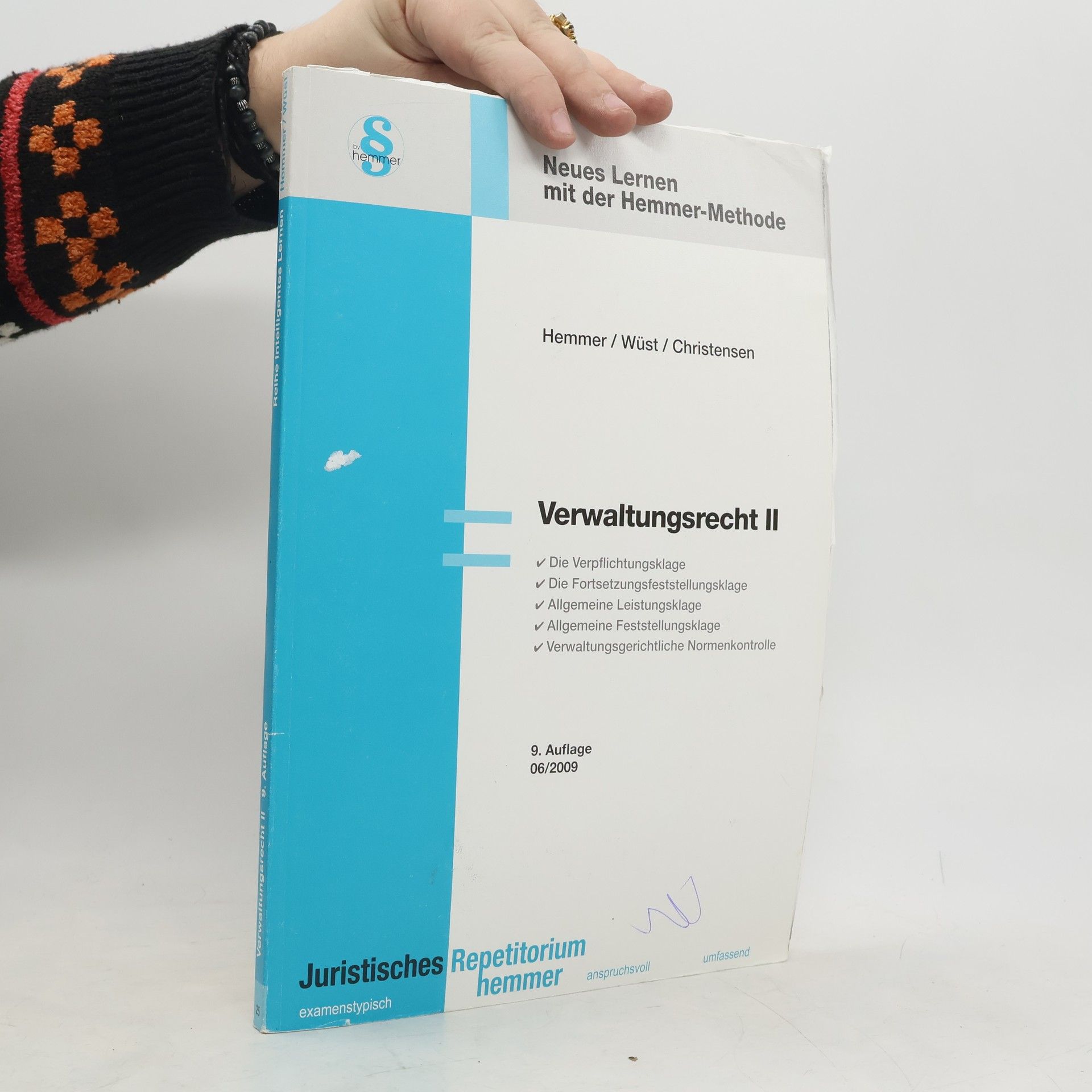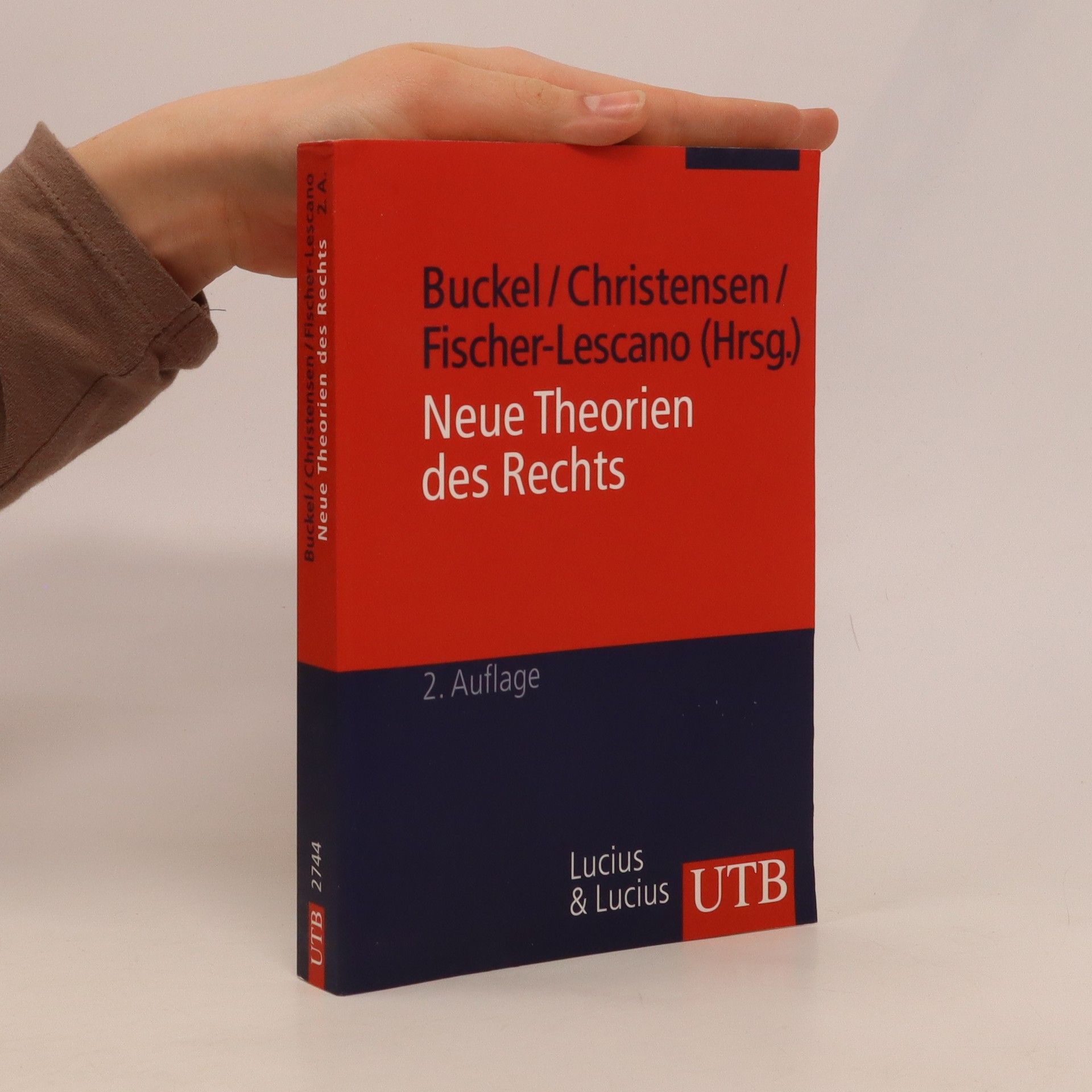Juristische Methodik. Bd.1
Grundlegung für die Arbeitsmethoden der Rechtspraxis
- 701bladzijden
- 25 uur lezen
Die Neuauflage behandelt aktuelle Entwicklungen in Praxis und Wissenschaft und bietet sowohl Problemanalysen als auch Lösungsvorschläge. Sie integriert lebhafte Diskussionen zu zentralen Themen wie 'Wortlautgrenze' und 'Richterrecht', die die Gesetzesbindung betreffen. Zudem werden Grundlagen und Techniken der Abwägung, der Wandel von Realität und Normen sowie die Rolle der Ethik im Recht thematisiert. Auch die Kriterien für die Vertretbarkeit juristischer Entscheidungen und die Strukturen der Legitimation im demokratischen Rechtsstaat finden Berücksichtigung.