Die Geschichte der Familien Stähelin-Staehelin-Stehelin beginnt im 16. Jahrhundert mit Hans Stehelin, einem aus Süddeutschland eingewanderten Handwerker. Das Buch beleuchtet die Rolle der Familie in der Stadtrepublik Basel und thematisiert Aspekte wie Reformation, Handel und Wissenschaft, einschließlich der Perspektiven von Außenseitern und Auswanderern.
Urs Hafner Boeken
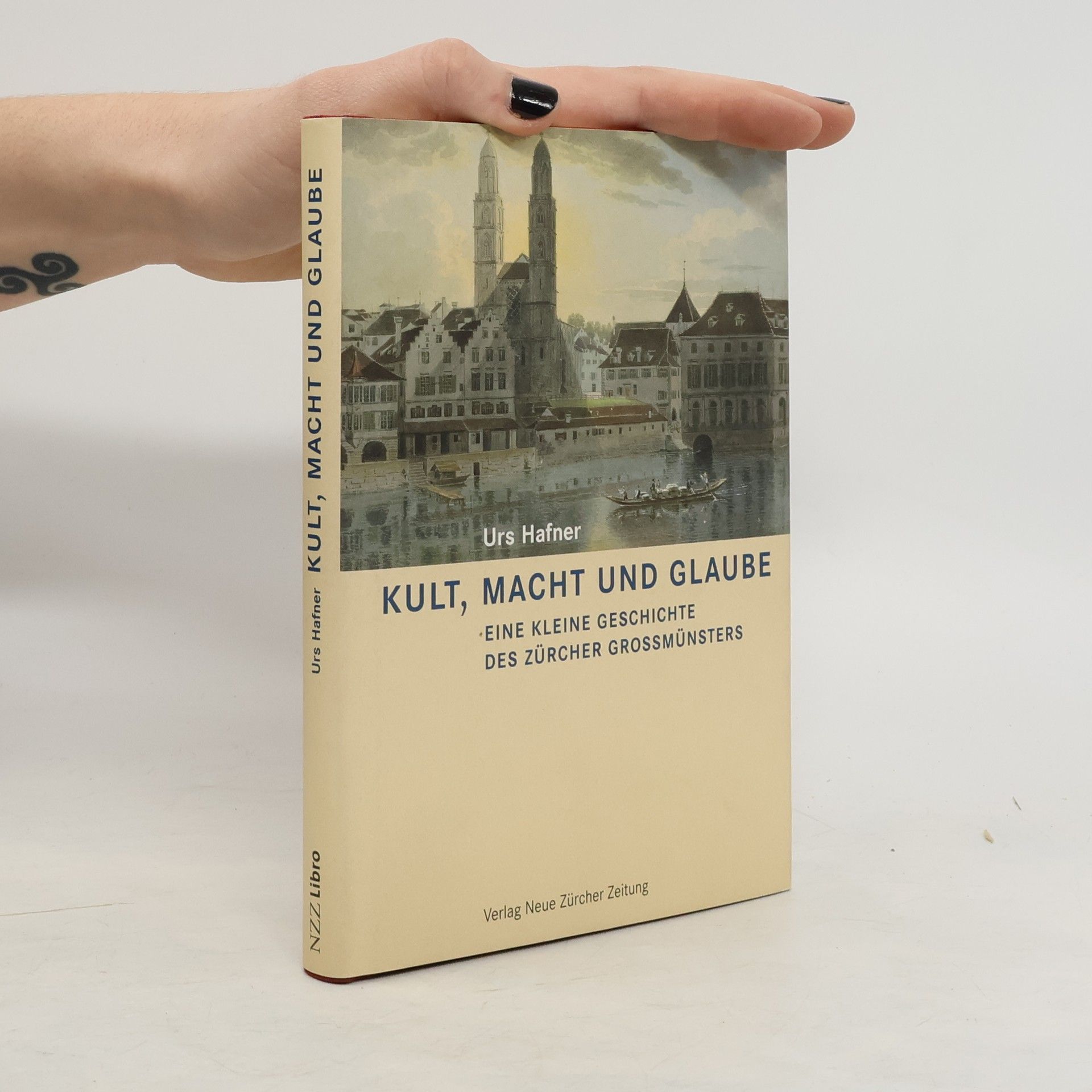
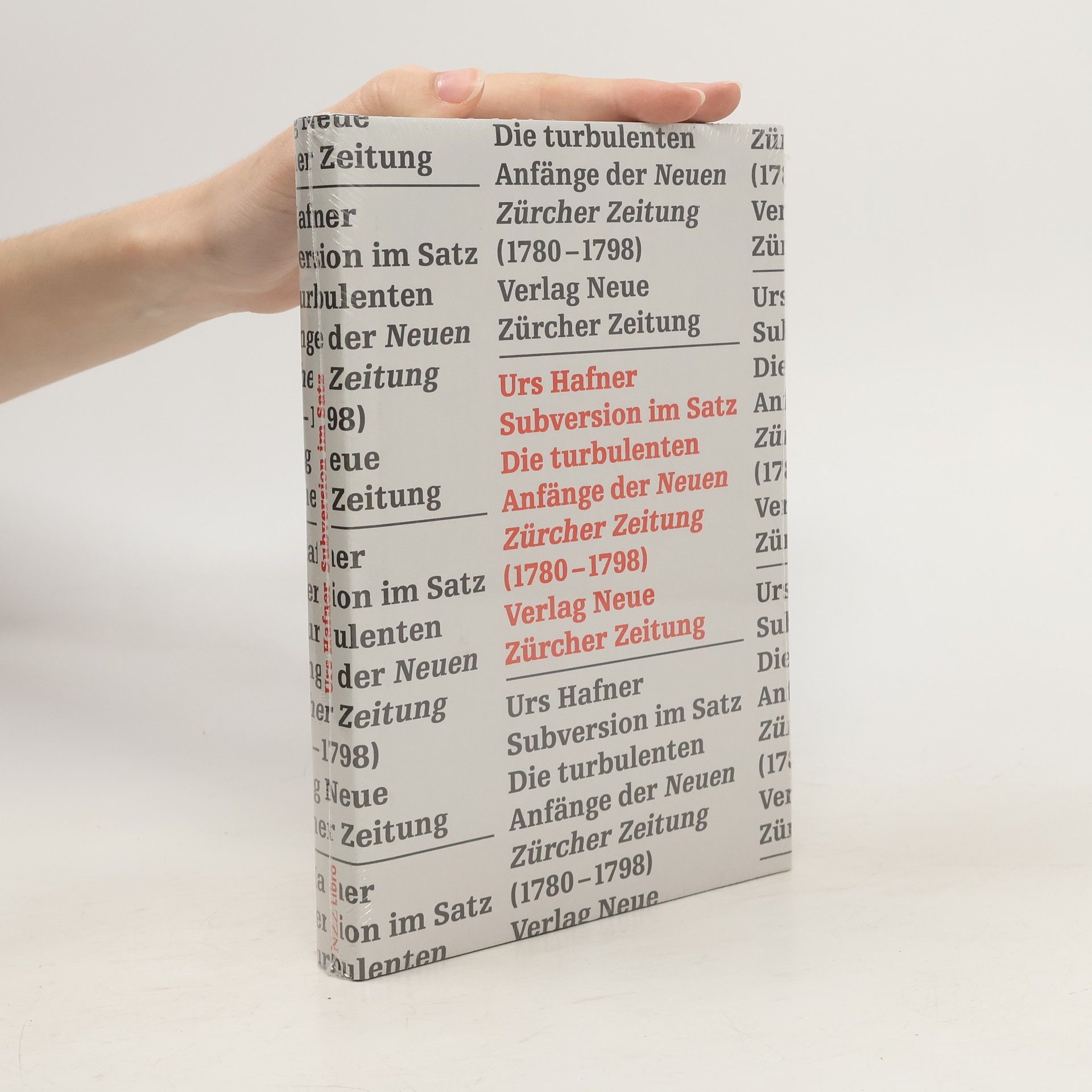


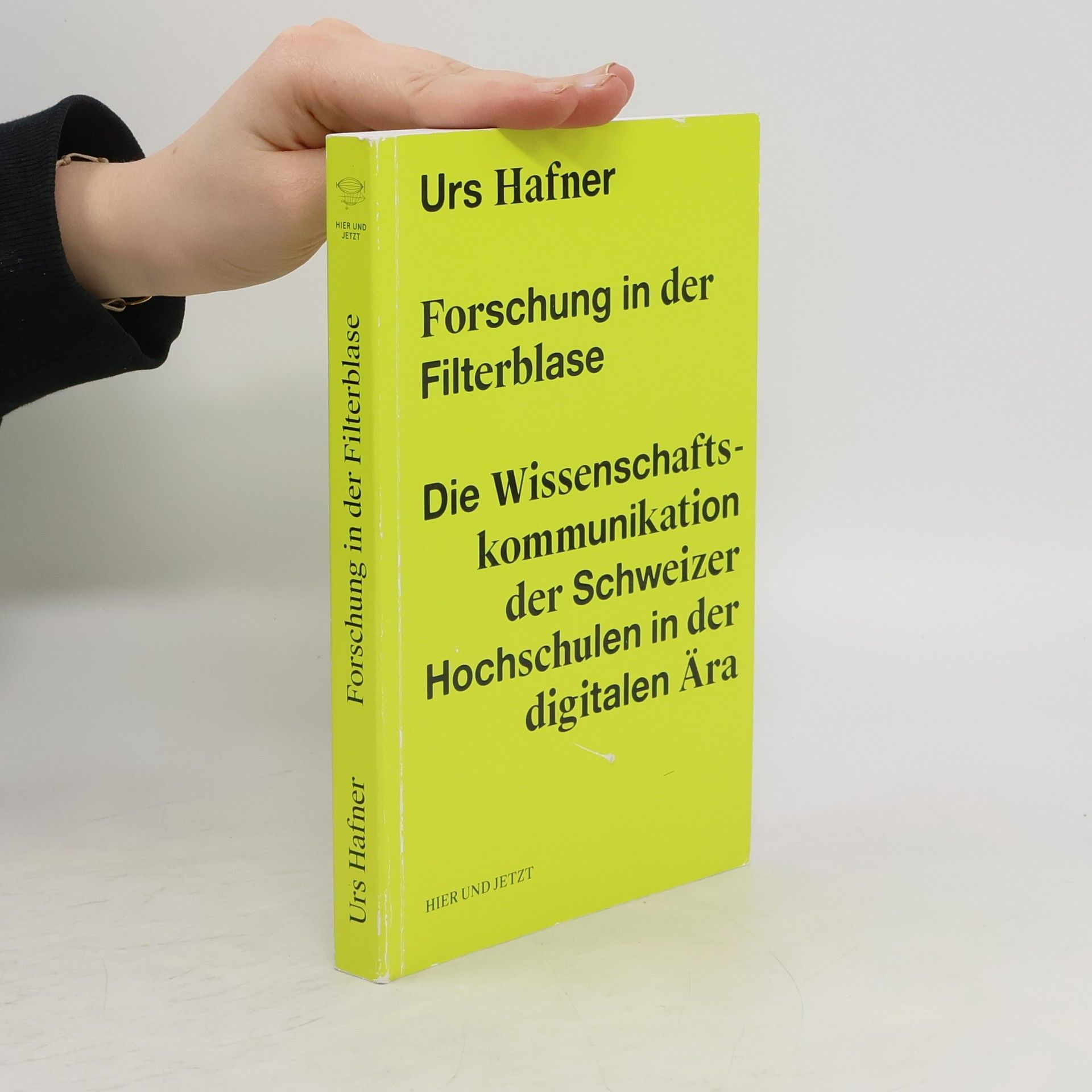

Forschung in der Filterblase
Die Wissenschaftskommunikation der Schweizer Hochschulen in der digitalen Ära
Die Schweizer Hochschulen bauten in den letzten Jahren ihre Kommunikationsstellen massiv aus, insbesondere im Bereich Social Media. Sie erhoffen sich davon die zielgenaue Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger sollen besser über die Leistungen der von ihnen finanzierten Forschung informiert werden. Denn unbestritten gilt: In der demokratischen Wissensgesellschaft muss zwischen Forschung und Publikum ein offener Dialog geführt werden, in beiderseitigem Interesse. Doch die Kommunikationsstellen wenden sich von der breiten Öffentlichkeit ab. Sie betreiben primär Reputationsmanagement und Community-Building der aktuellen und künftigen Studierenden, also ihrer < >. Sie kommunizieren wie Unternehmen und vernachlässigen den Diskurs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und die Medien übernehmen die professionell aufbereiteten Erfolgsmeldungen dankbar. Wer springt in die Bresche? Urs Hafner ist freiberuflicher Historiker, Autor und Journalist. Von 2007 bis 2014 arbeitete er als Wissenschaftsredaktor beim Schweizerischen Nationalfonds. Bei Hier und Jetzt publizierte er < > (2011), 2015 erschien < >. Er lebt in Bern. (Quelle: Verlag)
Karl Bürkli
Der Sozialist vom Paradeplatz
Der Patrizier Karl Bürkli (1823–1901), der am Zürcher Paradeplatz aufwuchs, war einer der ersten Sozialisten der Schweiz. Ohne den intellektuellen Kneipenwirt gäbe es keine direkte Demokratie, keinen Coop, keine Zürcher Kantonalbank. Er hat die moderne Schweiz mitgestaltet und fast alles und alle angegriffen: den Kapitalismus und Alfred Eschers Schweizerische Kreditanstalt, die eidgenössische Nationalgeschichte und die Professoren der ETH und der Universität Zürich, das Militär und die Ehe. Marx und Bakunin belächelten Bürkli. Ihm war das egal. In Texas wagte er eine utopische Kommune, in Nicaragua geriet er zwischen die Fronten des Kolonialkriegs. Er war für das Frauenstimmrecht (in der Theorie), den Naturschutz und die freie Liebe. Und blieb doch allein.
Kinder beobachten
Das Neuhaus in Bern und die Anfänge der Kinderpsychiatrie, 1937–1985
Subversion im Satz
Die turbulenten Anfänge der «Neuen Zürcher Zeitung» (1780–1798)
Sie waren jung und rebellisch, auf der Flucht und im Gefängnis. Sie trotzten der Zensur, legten sich mit kirchlichen und weltlichen Autoritäten an und hofften auf eine freie und gerechte, auf eine «aufgeklärte» Welt. Sie waren belesen und schrieben Bücher, sie lebten in Not und zweifelten an Gott, sie waren verfemt und zäh. Und sie immigrierten fast alle aus dem katholischen Süddeutschland – die ersten Redaktoren der NZZ. Heute steht der Zeitungsjournalismus auf dem Prüfstand. Wie er die Herausforderungen der Digitalisierung und der veränderten Lesegewohnheiten der Digital Natives meistern wird, ist offen. In diesem für den Journalismus prekären Moment ist der Blick in seine Anfänge erhellend. Die Entstehungsgeschichte der 1780 gegründeten «Zürcher Zeitung», der ältesten Zeitung der Schweiz und einer der ältesten politischen Zeitungen weltweit, zeigt beispielhaft, wie sich der moderne liberale Journalismus formiert hat: mutig, kämpferisch, aufklärerisch.