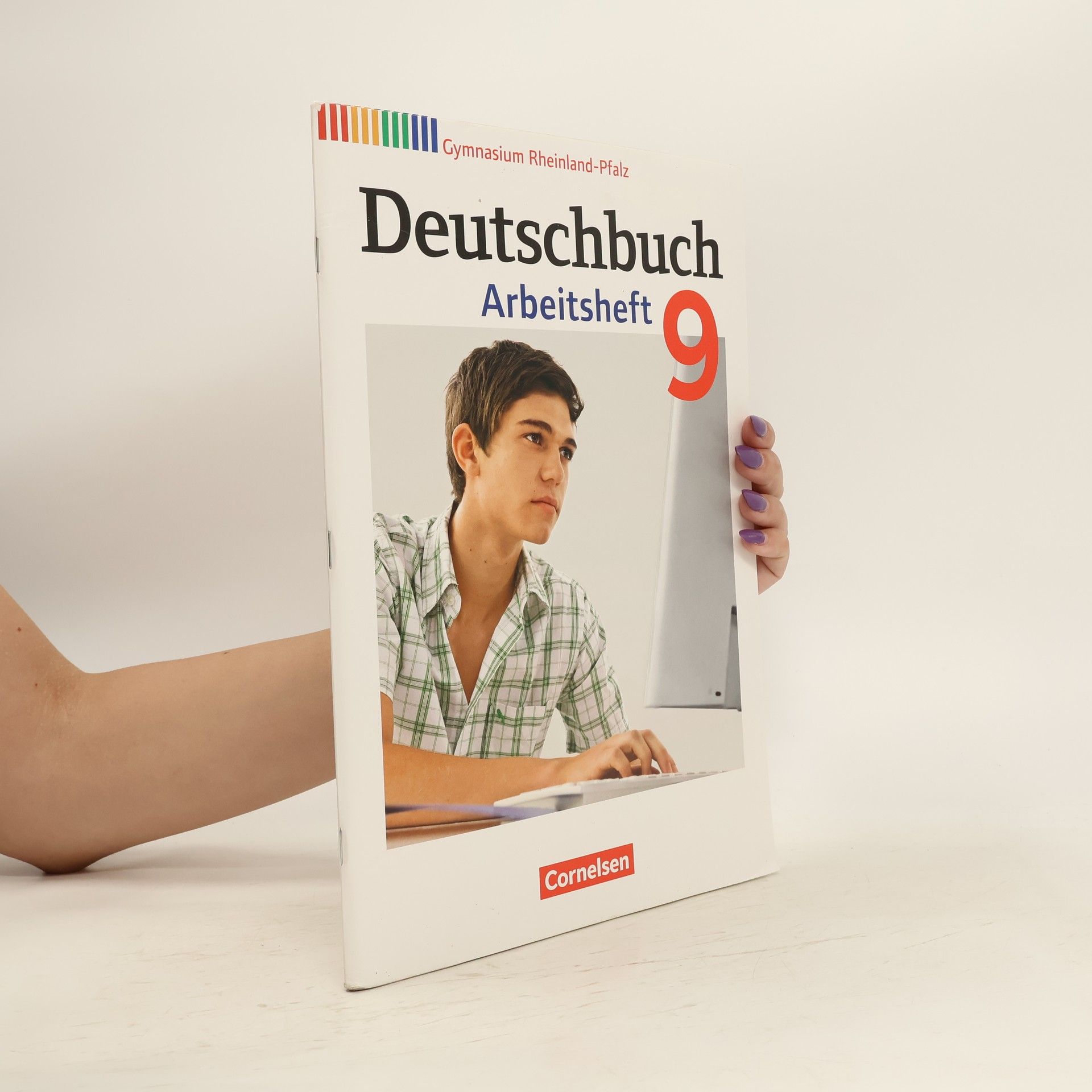Deutschbuch
- 112bladzijden
- 4 uur lezen
Umfangreiches Übungsmaterial zu den Bereichen Grammatik, Rechtschreibung, Schreibformen und Leseverständnis (Umgang mit Texten und Medien) Eingangsdiagnose, Differenzierungsangebote und Lernstandstest Herausnehmbarer Lösungsteil Auch unabhängig vom Schulbuch einsetzbar