Eckhard Gruber Boeken




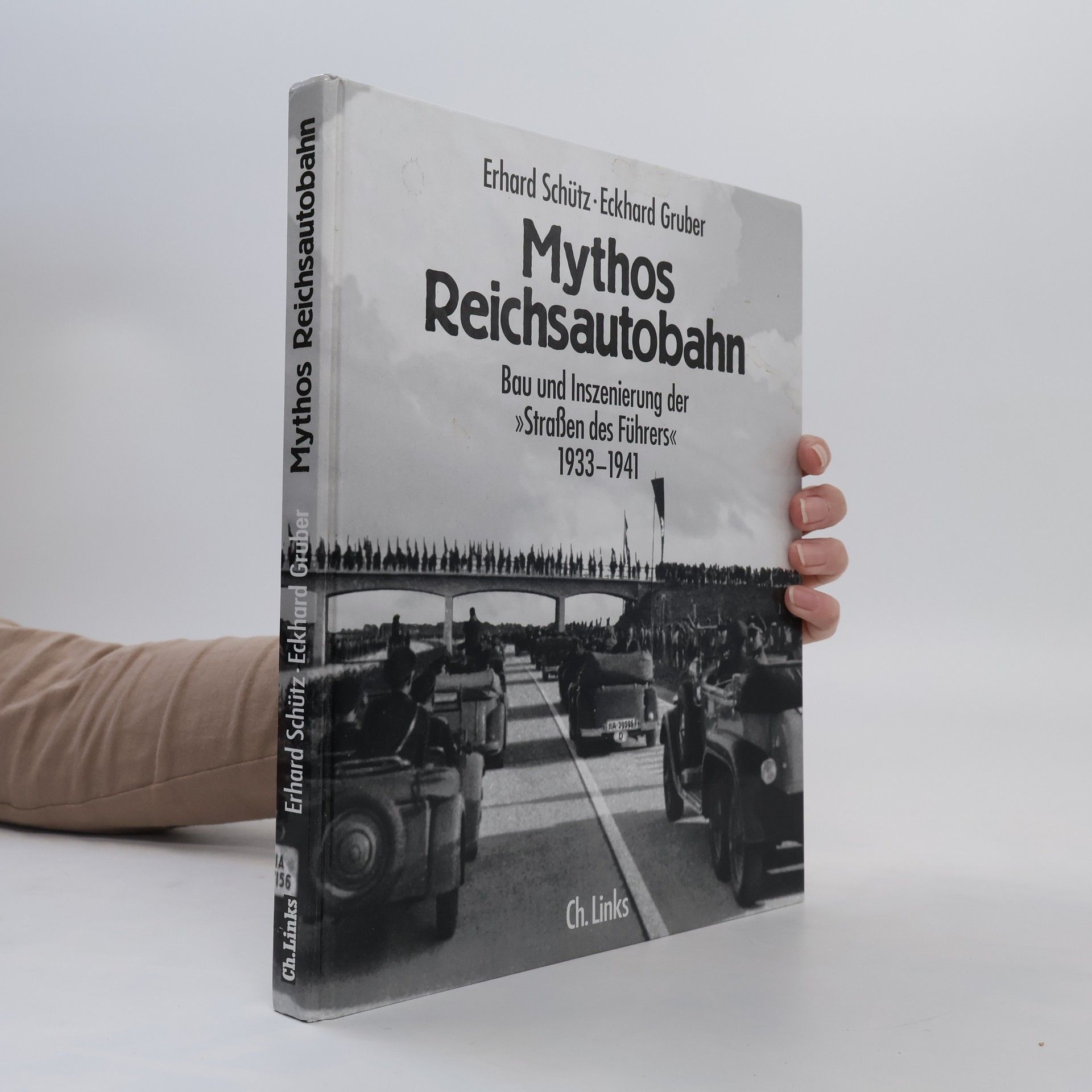
Berliner Radpartien
Auf dem Zweirad durch 150 Jahre literarischen Stadtverkehr
Das Fahrrad hatte es nie leicht in Berlin. Mit ihren breiten Magistralen und großen Entfernungen schien die Metropole der Inbegriff für motorisierte Mobilität. Die ‚Tempostadt‘ gierte nach schneller, bequemer Fortbewegung – wie sie Stadtbahn, U-Bahn und Auto versprachen. Trotzdem hat sich auch hier seit Ende des 19. Jahrhunderts das Fahrrad Bahn gebrochen und ist seither nicht mehr aus dem Stadtbild und Stadtverkehr wegzudenken. Das Fahrradfahren in Berlin boomt geradezu in den letzten Jahren. Dabei brauchte es schon besondere Umstände und eine spezifische Mentalität, um sich mit Muskelkraft auf zwei Rädern ins Getümmel zu begeben: Mut, Gesundheitsbewusstsein, Sportsgeist, Unabhängigkeit, Durchsetzungsvermögen – oder auch nur einen Hauch von Snobismus. „Berliner Radpartien“ versammelt die schönsten literarischen Texte aus 150 Jahren Berliner Fahrradgeschichte. Bekannte Namen wie Walter Benjamin, Elke Erb, Mascha Kaléko, Alfred Kerr, Heinz Knobloch, Gabriele Tergit und Max Goldt sind unter den Autoren, aber auch Wiederentdeckungen wie Ferdinand Runkel oder Richard Christ. Hintergrundgeschichten und erläuternde Kommentare des Herausgebers vervollständigen das Kompendium Berliner Fahrradgeschichte.
Good-bye für heute
- 224bladzijden
- 8 uur lezen
Berlin 1926: Die junge Medizinstudentin Karin lebt mit ihrer Mutter Jean und ihrem Zwillingsbruder Erhard nach dem Tod des Vaters im einstigen Stadtdomizil der Familie am Lützowplatz. Nach Krieg und Inflation eröffnen sich in der Weimarer Republik neue Freiheiten und Perspektiven und Karin blickt ihrer Zukunft voller Neugier und Zuversicht entgegen. Doch nicht nur die einst herrschaftliche Wohnung ist nach dem Krieg geteilt und zimmerweise vermietet, auch durch die Familie ziehen sich Risse. Während die gebürtige US-Amerikanerin Jean, die seit dem Tod ihres Mannes Graf Tarnowitz wieder als Journalistin arbeitet, als überzeugte Demokratin den erzkonservativen Einstellungen ihrer adligen Schwiegerfamilie fernsteht und Karin der sozialistischen Partei beitreten möchte, wünscht sich Bruder Erhard die Monarchie zurück und ist fanatischer Nationalist und Antisemit. Die Konflikte in der Familie und die zunehmende Radikalisierung des Bruders überschatten Karins Studienjahre – bis schließlich ein Attentat geschieht. Auch für Jean, die sich nach dem Ende ihrer unglücklichen Ehe beruflich und privat neu zu orientieren versucht, stellt eine unerwartete Konfrontation mit der Vergangenheit einiges auf den Kopf. Goldsmith verzahnt in ihrem Debütroman von 1928 die polarisierte politische Stimmung in Berlin mit den alltäglichen Zwistigkeiten der Familie und beschreibt eine Gesellschaft am Kipppunkt. Im Aufeinandertreffen unterschiedlichster Romanfiguren, darunter der jüdische Rechtsanwalt Herbert Mendelssohn, der englische Maler Martin Trevelyan und der US-amerikanische Schriftsteller Mark Huntington, schildert sie plastisch die Prägungen verschiedener kultureller Milieus und Herkunftsländer. Zugleich entwirft sie ein lebendiges Bild zweier Generationen sich emanzipierender Frauen, von deren Kampf um Gleichstellung, gesellschaftliche Anerkennung und neue Sexualmoral.