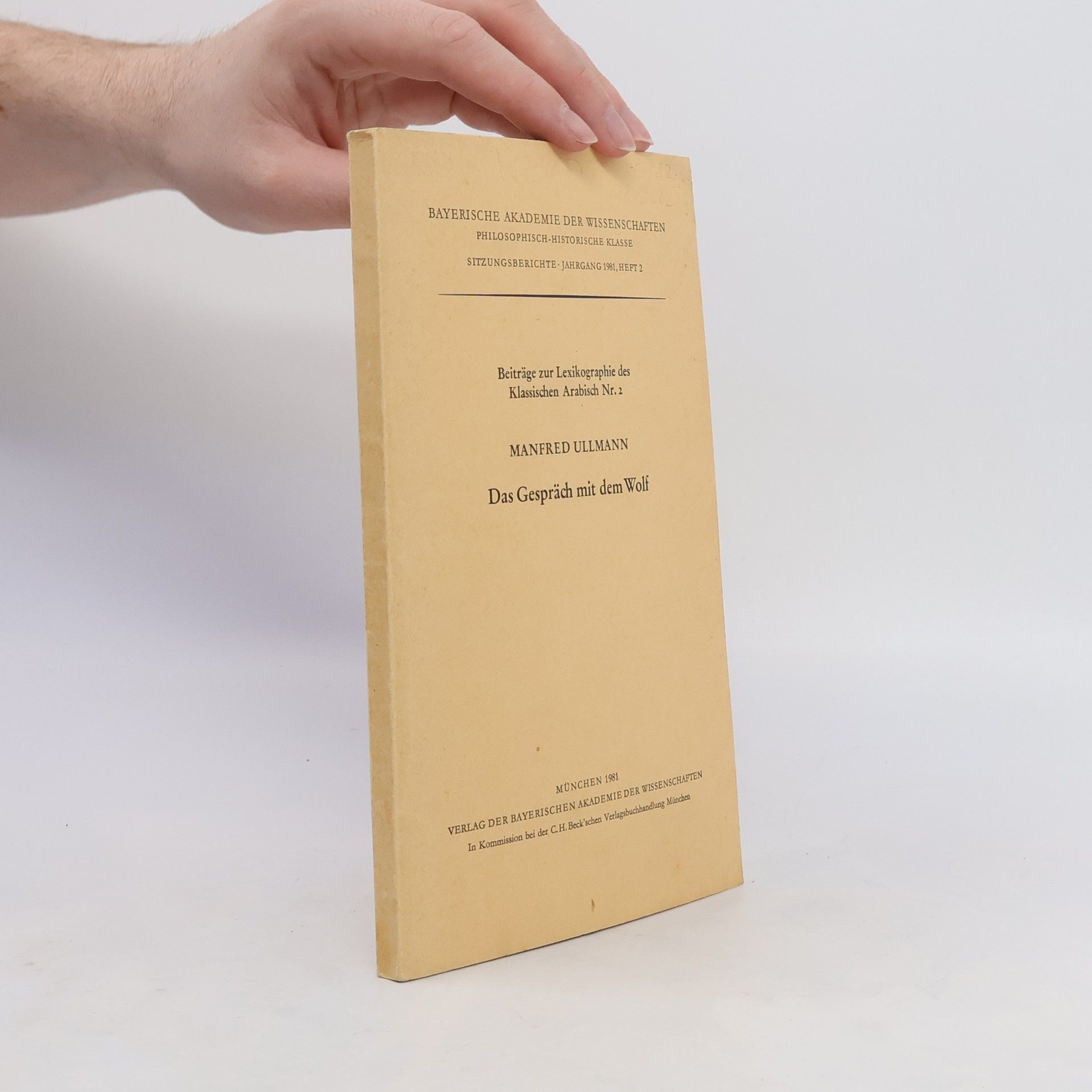Wörterbuch zu den griechisch-arabischen Übersetzungen des 9. Jahrhunderts
- 668bladzijden
- 24 uur lezen
Der dritte Supplementband des Wörterbuchs zu den griechisch-arabischen Übersetzungen des 9. Jahrhunderts beruht auf arabischen Handschriften, die erst vor wenigen Jahren bekannt geworden sind. Ihr Inhalt sind griechische Lehrbücher der Landwirtschaft, die zum Ende des 8. und in der Mitte des 9. Jahrhunderts ins Arabische übersetzt worden sind. Die behandelte Bandbreite an landwirtschaftlichen Themen wie die Bodenbearbeitung und Düngung, der Anbau von Getreide und Gemüse, der Weinbau, die Vieh-, Geflügel- und Fischzucht, die Arbeitsbedingungen der Landarbeiter und Wetterprognosen sind von den arabischen Lexikographen des Mittelalters nicht berücksichtigt worden. Da die europäischen Wörterbücher (Freytag und Lane) lediglich das von den Arabern gelieferte Material reproduzierten, fehlen die landwirtschaftlichen Begriffe dort. Dieses Werk von Manfred Ullmann enthält somit einen bisher weitgehend unbekannten Wortschatz, der auf die griechischen Lemmata zurückzuführen ist. Ullmann demonstriert dabei unter anderem, mit welchen Mitteln drei verschiedene Übersetzer denselben griechischen Begriff im Arabischen wiedergaben. Durch einen 76 Seiten starken Index sind alle arabischen Stichwörter übersichtlich erfasst.