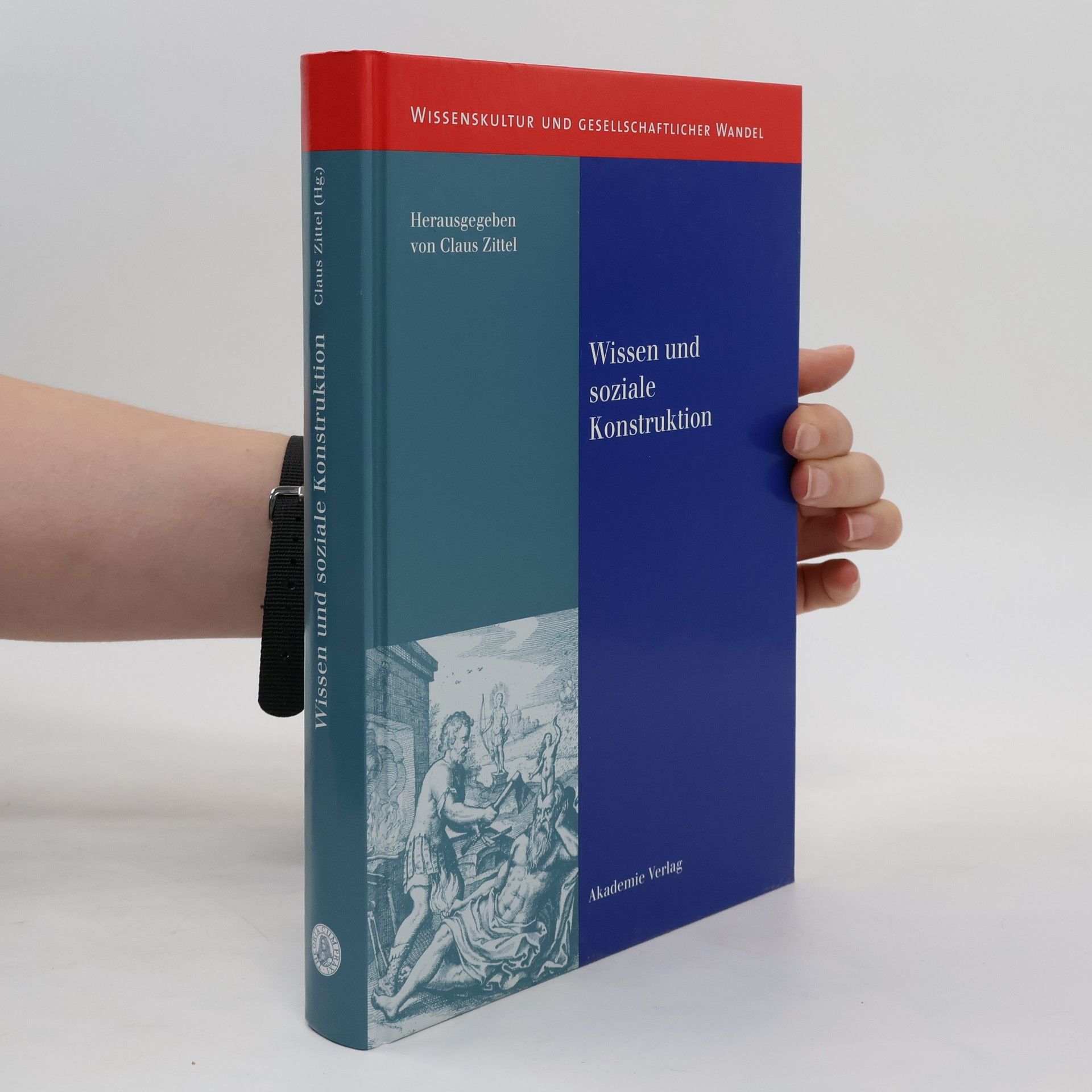Wissen und soziale Konstruktion
- 301bladzijden
- 11 uur lezen
In der Wissenschaftsgeschichte zeichnet sich ein Wandel ab: Der traditionelle Streit über die Bedeutung sozialer versus wissenschaftsimmanenter Faktoren bei der Wissensproduktion wird zunehmend hinterfragt. Stattdessen wird die Unterscheidung zwischen sozial konstruierten und ‚wissenschaftlichen‘ Elementen selbst zum Forschungsgegenstand. Wissenschaft wird nicht mehr primär als Theorie, sondern als kulturelle oder soziale Praxis betrachtet, die in spezifischen Kontexten verankert ist. Die klassischen Kriterien zur Rechtfertigung von Wissen werden in ihren sozialen und kulturellen Zusammenhängen analysiert. Der vorliegende Band versammelt Aufsätze aus verschiedenen Disziplinen wie Philosophie, Geschichtswissenschaft, Wissenschaftstheorie, Ethnologie und Soziologie, die diese neue Perspektive anhand von Fallstudien und theoretischen Überlegungen beleuchten. Die Beiträge von Alexander Becker, Cora Bender, Wolfgang Detel, Uljana Feest, Gundula Grebner, Hajo Greif, Thomas Kailer, Katrin Koehl, Andreas Niederberger, Alfred Nordmann, Ulrich Oevermann, Trevor Pinch und Claus Zittel bieten vielfältige Einsichten in die aktuelle Diskussion über die Natur von Wissenschaft und Wissen.